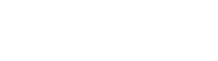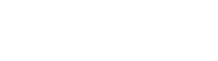NLP aus Sicht der Hirnforschung

NLP und die Neurodidaktik
Wie beeinflusst Kommunikation den Erfolg von Übergaben? Mithilfe des Neurolinguistischen Programmierens (NLP) und Erkenntnissen aus der Hirnforschung zeigen wir, wie klare Sprache und gezielte Kommunikation neuronale Muster positiv beeinflussen. Der Artikel vermittelt praxisnahe Techniken, um Blockaden zu lösen, Verständnis zu fördern und Unsicherheiten zu reduzieren – für reibungslose und effektive Prozesse.
Das Neurolinguistische Programmieren (NLP) trägt den Bezug auf die neuronalen Grundlagen des Denkens, Fühlens und Handelns programmatisch im Namen und setzt diesen Anspruch durch seine veränderungswirksamen Methoden effektiv ins Werk. Angesichts der pragmatischen Ausrichtung des NLP an der Maxime „Was funktioniert, hat Recht“, fehlen oft jedoch die theoretischen und empirischen Fundamente, auf deren Grundlage sich Wirksamkeit überprüfen und kommunizieren lässt. Gerade diese Anbindung an wissenschaftliche Diskurse aber ist für die Weiterentwicklung und Positionierung von NLP unabdingbar.
Ein naheliegender Ansatzpunkt für die Integration von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen ins NLP ist die Neurodidaktik, welche sich mit der Anwendung lernphysiologischer Befunde auf gehirngerechtes Lehren und Lernen beschäftigt (Hütter & Lang, 2024). Lernen wird dabei nicht nur auf schulische Kontexte begrenzt, sondern umfasst lebenslanges Lernen in allen Bereichen – sei es der Umgang mit beruflichen Anforderungen, das Meistern emotionaler Herausforderungen oder die Veränderung ungeliebter Gewohnheiten. Hier liefert die Hirnforschung wertvolle Einsichten darüber, wie Lernprozesse optimiert werden können.
Die Pädagogikprofessorin Renat Nummela-Caine, die Pionierin des „Brain Based Learning“, identifizierte 12 neurodidaktische Prinzipien, die gehirngerechtes Lernen in der Schule unterstützen sollten (Caine et al. 2005). Sandra Mareike Lang und ich haben diese Prinzipien im Buch „Neurodidaktik für Trainer“ auf die Erwachsenenbildung und Personalentwicklung übertragen (Hütter & Lang, 2024). Dabei zeigt sich, dass NLP-Methoden optimal genutzt werden können, um diese Prinzipien umzusetzen.
Auf den folgenden Seiten stelle ich gängige Konzepte und Methoden des NLP in den Kontext der neurodidaktischen Prinzipien, auf denen ihre Wirkung beruht. Durch eine systematische Verbindung von NLP mit neurodidaktischen Wirkprinzipien lassen sich nicht nur NLP-Methoden gezielter einsetzen, sondern auch deren Nutzen klarer kommunizieren. Zudem entstehen neue kreative Möglichkeiten, wie NLP-Formate auf Basis neurowissenschaftlicher Erkenntnisse weiterentwickelt werden könnten.
Prinzip 1: Lernen ist ein physiologischer Vorgang
Dieses erste Prinzip verweist auf das grundlegende Konzept der Neuroplastizität, die Grundlage für alle Lernvorgänge bildet. Denn dauerhaftes Lernen findet nur dann statt, wenn sich die neuronalen Strukturen im Gehirn organisch transformieren. Neue Synapsen entstehen, alte Verbindungen werden gelöst, und zuvor schwache Verknüpfungen können zu starken neuronalen „Autobahnen“ ausgebaut werden. Dies geschieht, indem emotional bedeutsame Erfahrungen über Genexpression und Proteinbiosynthese zu strukturellen Veränderungen im Konnektom des Gehirns führen. Damit Lernen erfolgreich ist, sind Zeit und wachstumsfördernde Bedingungen wie Schlaf, Bewegung, emotionale Beteiligung und die Aktivierung mehrerer Sinneskanäle essenziell.
Genau hier setzt NLP an. Der innere und äußere Gebrauch aller Sinne (VAKOG) ist ein zentrales Wirkelement in der Anwendung des NLP. Längst bevor durch die Embodiment-Forschung die Körperlichkeit unserer psychischen Prozesse auf breiter empirischer Basis erkennbar wurde (Storch et al. 2022), entdeckte NLP unser Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken als primären Zugang zum subjektiven Erleben und zur emotionalen Intensität. Damit sind die weitaus abstrakteren Kategorien wie Gefühle, Werte und Glaubenssätze, mit denen auch andere Coaching- und Therapie-Ansätze arbeiten, im NLP immer im physiologischen Geschehen verankert. Das verstärkt die sinnliche und emotionale Intensität und mit ihr den neuroplastischen Impact von Kommunikation und Coaching.
Insbesondere jene Untereigenschaften der Sinneskanäle, die wir im NLP als Submodalitäten bezeichnen, sind in der Hirnforschung für ihren Beitrag zur Wirklichkeitskonstruktion des Gehirns bekannt. So stellen etwa visuelle Merkmale wie Helligkeit, Kontrast, Nähe, Farbe etc. eine Heuristik des Gehirns dar, den Realitätsstatus einer Vorstellung einzuschätzen (Roth, 2011). Das Grundprinzip: je detailreicher die Vorstellung, desto realer und anziehender wirkt sie auf uns und desto wahrscheinlicher werden zielführende Handlungen ausgelöst.
Wenn wir NLP-Anwendern also beibringen, die eigene Vorstellungskraft zu trainieren, geben wir ihnen damit ein mächtiges Instrument an die Hand, die Regie über ihr physisches Gehirn zu übernehmen und das eigene neuronale Networking in wünschenswerte Bahnen zu lenken.
Prinzip 2: Das Gehirn ist sozial.
Lernen ist nicht nur ein individueller Prozess, sondern tief in sozialen Interaktionen verankert. Unser Präfrontalkortex, das Zentrum für höhere kognitive Funktionen wie Denken, Planen und zielgerichtetes Handeln, hat sich evolutionsbiologisch vor allem entwickelt, um die Komplexität sozialer Beziehungen zu bewältigen (Grossmann, 2013). Kooperation ist unser größter Überlebensvorteil, und soziale Bindungen aktivieren unser Bindungssystem, das durch die Ausschüttung von Oxytocin verstärkt wird. Dieses Hormon fördert nicht nur Motivation und den Stressabbau, sondern aktiviert auch die Spiegelneuronen, die uns durch Imitation von Vorbildern mit Leichtigkeit lernen lassen (Hütter, 2018).
Hier knüpft NLP direkt an. Eines seiner Kernelemente ist das Modeling – die bewusste Übernahme erfolgreicher Verhaltensmuster von Vorbildern. Diese Technik nutzt die natürliche Funktion des sozialen Gehirns, Wissen durch Nachahmung zu erwerben. Schließlich gehört das Imitationslernen am sozial nahen Vorbild zu den mächtigsten Formen des Lernens. Doch NLP geht weiter: Es schafft durch seinen besonderen Fokus auf den Rapport, also den Aufbau einer tiefen, empathischen Verbindung, auch für intuitives Lernen am Vorbild die optimalen Voraussetzungen. Schließlich fördert ein guter Rapport die Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin. Oxytocin wiederum verbessert über die Ankurbelung des Dopamin-Systems die Motivation und durch die Dämpfung der hormonellen Stressachse das entspannte Lernen. Vor allem aber fördert Oxytocin die Aktivierung der Spiegelneuronen, die die neuronale Hardware des Imitationslernen darstellen und die das implizite Modell-Lernen ermöglichen.
Auch mit dem Kalibrieren – dem genauen Wahrnehmen der States und der Physiologie des Gegenübers – sowie mit dem gezielten Einsatz von Spiegelung, sowohl auf körpersprachlicher Ebene als auch durch aktive Zuhörstrategien, stellt NLP die Beziehung wirksam in den Mittelpunkt. So zeigen aktuelle Studien, dass Spiegelverhalten mit kollaborativer Interaktion und dem Aufbau von gemeinsamen Zielen verbunden ist (Reed, 2020).

Prinzip 3: Die Suche nach dem Sinn ist angeboren
Unser Gehirn ist dafür ausgelegt, Bedeutungen zu erkennen und Sinn zu erzeugen. Der Hippocampus, der Organisator unseres bewusstseinsfähigen Gedächtnisses, dient als Mustererkennungsdetektor, der neue Erfahrungen mit bekannten Mustern abgleicht, während der Präfrontalkortex diese Informationen integriert und ihnen Bedeutung verleiht. Ein klar erkennbarer Sinn steigert Motivation und Wohlbefinden – wie unter anderem Viktor Frankl (Logotherapie) und Aaron Antonovsky (Sense of Coherence Konzept im Salutogenese-Ansatz) in ihren Arbeiten zeigen (Frankl, 1984; Antonovsky, 1987).
Das NLP greift diese natürliche Sinnorientierung unseres Denkorgans auf und bietet konkrete Werkzeuge, um sie zu unterstützen. Ein zentrales Konzept ist das der „wohlformulierten Ziele“, die ein Ziel durch positive Formulierung, sinnliche Wahrnehmbarkeit, persönlichen Einfluss, Kontextualisierung und eine Kosten-Nutzen-Abwägung (Öko-Check) mit bedeutsamen inneren Repräsentationen aufladen und damit massiv mit Sinn anreichern. Dies steigert die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung enorm, indem es die Konsistenz gleichzeitig aktivierter neuronaler Erregungen (cf. Grawe 2004) erhöht und damit die Handlungsenergie bündelt.
Darüber hinaus nutzt NLP Framing-Techniken, um Lerninhalte oder Vorhaben in einen größeren Kontext einzubetten. Nach dem 4MAT-Konzept von Bernice McCarthy umfasst das Framing vier zentrale Komponenten: Warum, Was, Wie und Was-wenn. Dabei stehen der Inhalt (Was), die Methode (Wie) und der Transfer (Was, wenn) klar unter dem Primat des motivierenden Nutzens (Warum). Wenn wir das berühmte „Start with Why“ (Sinek, 2009) in unseren Reden, Seminaren, Arbeitsanweisungen, in unserer Change-Kommunikation und in unseren Verkaufsgesprächen als Einstieg nutzen, schaffen wir einen Rahmen für unsere Kommunikation, der direkt an das Motivationssystem unseres Gegenübers andockt.
Ist dagegen eine persönliche Sinnkonstruktion problemerzeugend, zum Beispiel, weil ich meinen hohen Qualitätsanspruch als Pedanterie diffamiere, so haben wir mit den unterschiedlichen Varianten des Reframings wunderbare Möglichkeiten, uns selbst und unseren Klienten und Klientinnen ressourcenreichere Sinnangebote zu machen.
Prinzip 4: Sinnessuche funktioniert durch Bildung neuronaler Muster.
Lernen geschieht, indem neue Informationen an bestehende neuronale Muster angeknüpft werden. Denn der Aufbau neuer Muster erfordert stets die Koppelung an vorhandene Strukturen. Im NLP wird dieses Prinzip insbesondere durch das Konzept des „Pacing und Leading“ umgesetzt. Pacing stellt – als Kunst der Anknüpfung an Haltung und Verhalten des Gegenübers – die Grundlage für neuronale Anschlussfähigkeit von Kommunikation dar. Erst darauf aufbauend führt das Leading zu neuen Perspektiven und Verhaltensweisen. Auf diese Weise können wir nicht nur an momentan aktivierte Zustände unserer Gesprächspartner oder Klienten anknüpfen, sondern können auch überdauernde und mächtige neuronale Schemata wie Werte und Glaubenssätze wirksam bearbeiten.
Prinzip 5: Emotionen sind wichtig für die Musterbildung.
Unsere neuronalen Netzwerke entwickeln sich durch synaptische Plastizität. Wer aus einem neuronalen Trampelpfad eine gut gebahnte Gewohnheit machen will, kommt um den „neuronalen Straßenbau“ nicht herum. Dieser ist manchmal anstrengend und braucht jede Menge an emotionaler Energie. Denn Neurotransmitter wie Dopamin und Noradrenalin, die bei starken Emotionen ausgeschüttet werden, stoßen eine biochemische Signalkaskade an, die zur Genexpression und zur Synthese von Eiweißbausteinen führt – sozusagen dem Asphalt für den neuronalen Straßenbau (cf. McReynolds & McIntyre 2012). Mit anderen Worten: Emotionen sind die Seramis-Stäbchen im neuronalen Blumentopf!
Im NLP gibt es zahlreiche Techniken, um Emotionen gezielt zu aktivieren und zu steuern. Eine davon ist das Ankern, bei dem emotionale Zustände durch spezifische Auslöser wieder abrufbar gemacht werden. Diese Methode hilft Menschen, sich in gewünschte Zustände wie Selbstvertrauen oder Motivation zu versetzen, zum Beispiel vor wichtigen Herausforderungen wie Bewerbungsgesprächen oder Präsentationen.
Weitere wertvolle Instrumente zur Regulation der emotionalen Betriebstemperatur sind die Metho-den zur Herstellung von Assoziation („mittendrin“) und Dissoziation („nur dabei“). Durch Assoziation können Menschen eine Situation intensiv und mit allen Sinnen erleben, während Dissoziation hilft, sich emotional zu distanzieren. Diese Techniken geben Menschen die Kontrolle über ihre Emotionen zurück und schaffen so eine wichtige Grundlage für das P des NLP, also das „Programmieren“ eigener neuronaler Erregungsbereitschaften und der Gestaltung künftiger Freiheitsgrade im Denken und Handeln.
Prinzip 6: Das Gehirn verarbeitet Informationen in Teilen und als Ganzes gleichzeitig.
Lernen erfolgt sowohl induktiv, durch das meist unbewusste Ableiten von Regeln aus Erfahrung (zum Beispiel beim Erwerb der Muttersprache) als auch deduktiv, indem Grundsätze zuerst vermittelt und dann praktisch angewandt werden (zum Beispiel im fremdsprachlichen Grammatikunterricht). Beide Ansätze sind für effektive Lernprozesse in unterschiedlichen Situationen wichtig.
NLP-Anwender erlernen das gezielte Arbeiten mit unterschiedlichen Chunk Levels, also den Abstraktionsebenen, auf denen Informationen verarbeitet werden: von detaillierten Einzelelementen bis hin zu großen Konzepten. Die so erzielte Flexibilität aus unterschiedlichen Konkretions- und Abstraktionslevels gibt geübten NLP-Anwendern in beiden didaktischen Modi Sicherheit. Als Seminarleiter können Sie beispielsweise ein Konzept präzise erklären und Teilnehmende dann ins Üben bringen (deduktiv). Sie können aber ebenso gut nach aktuellen Anliegen fragen, in den Anliegen Muster erkennen und spontan eine oder mehrere geeignete Interventionen dazu anbieten (induktiv). Das gibt Flexibilität im Handeln und ein hohes Maß an Bedürfnisorientierung in der Kommunikation.
Prinzip 7: Wir lernen durch gerichtete Aufmerksamkeit, aber auch durch periphere Wahrnehmung.
Unser Gehirn verarbeitet pro Sekunde schätzungsweise 11 Millionen Bits (Zimmermann, 1986), während unser Arbeitsgedächtnis 50 Bits oder weniger pro Sekunde prozessieren kann (Cowan, 2001). Wir nehmen also nur einen winzigen Bruchteil dessen, was wir verarbeiten, bewusst wahr. Da unser bewusstseinsfähiger Cortex ein enormer Energiefresser ist, ist diese Sparmaßnahme der menschlichen Natur eine energetische Notwendigkeit. Dennoch und gerade deshalb beeinflusst auch die unbewusste Verarbeitung unser Lernen erheblich. Die größten Lernkurven – vom Laufenlernen über den Spracherwerb bis zu Sozialisation – erklimmen wir nicht über explizites Regellernen, sondern durch intuitiven Kompetenzerwerb aus jahrelanger Erfahrung
Im NLP wird diese Dualität von gerichtetem und peripherem Lernen gezielt genutzt. Techniken wie die Arbeit mit Bodenankern erlauben es, Entscheidungen und Optionen sowohl bewusst zu reflektieren und zugleich rein intuitiv zu erspüren. So entsteht Raum für intuitive Einsichten und für das Auftauchen somatischer Marker (Damasio, 1996), die stimmige Entscheidungsprozesse erleichtern.
Auch Trance-Formate und Kreativitätstechniken wie die Disney-Methode wechseln gezielt zwischen Phasen bewusster Analyse („Realist, Kritiker“) und intuitivem Erleben („Träumer“), um kreative Lösungen und Einsichten zu fördern. NLP bietet damit ein gutes Gleichgewicht zwischen kognitiver Reflexion und intuitiver Erfahrung.

Prinzip 8: Wir können bewusst und unbewusst lernen.
Gehirn arbeitet in unterschiedlichen Betriebszuständen. Zwei zentrale Modi bestehen in der Aktivierung aufgabenkorrelierter Netzwerke (Task Positive Network), die bewusstes, zielgerichtetes Handeln ermöglichen, und dem Default Mode Network, das im Tagtraum-Zustand kreative Prozesse unterstützt. Beide Modi sind essenziell für effektives Lernen und Problemlösen (Raichle & Snyder, 2007).
Im NLP ist diese Dualität methodisch gut abgebildet. Das Metamodell der Sprache dient dazu, unbewusste Inhalte bewusst zu machen. Durch präzise Fragen können getilgte Informationen, unbewusste Vorannahmen oder unerkannte Ressourcen ins Bewusstsein geholt und bearbeitet werden. Dies aktiviert die exekutiven Funktionen des Frontalhirns und fördert die Mustererkennung und die bewusste Veränderungsarbeit.
Gleichzeitig bietet das Milton-Modell mit seinen hypnotischen Sprachmustern eine Grundlage, um mit dem Unbewussten in Kontakt zu kommen. In Trance-Zuständen wie sie in Hypnose erreicht werden, kommt es im Gehirn oft zu einer sogenannten Hypofrontalität, also einer leichten Minderperfusion des Frontallappens. Dieser Umstand fährt die kognitive Wachsamkeit inklusive der kritischen Selbstbeobachtung zurück. Wir werden offener für Neues und können unsere rationalen Abwehrstrategien temporär hinter uns lassen. Gleichzeitig werden sensorische Areale im visuellen, auditiven und kinästhetischen Cortex stärker aktiviert. Dadurch können lebhafte innere Bilder, Klänge oder Gefühle leichter abgerufen und genutzt werden. Das erlaubt es uns, unsere Vorstellungskraft und mir ihr den neuroplastischen Impact unserer inneren Bilder massiv zu verstärken (Halsband, 2009).

Prinzip 9: Es gibt mehrere Arten von Gedächtnis.
Neben dem deklarativen Gedächtnis, das Fakten und Ereignisse speichert, gibt es das prozedurale Gedächtnis für Abläufe und Routinen sowie das emotionale Gedächtnis, das Gefühle abspeichert. Diese Gedächtnisarten können unabhängig voneinander funktionieren oder versagen, was sich z. B. daran zeigt, dass manche Menschen trotz Verlust des deklarativen Gedächtnisses weiterhin neue Fertigkeiten erlernen können.
Ein Genre, das alle Gedächtnisarten anspricht, ist die Story. Geschichten aktivieren das episodische Gedächtnis, deren narrative Struktur unser auf Mustererkennung geeichter Hippocampus besonders gut verarbeiten kann. Gleichzeitig aktivieren sie durch ihre Handlungsabläufe und die Identifikation mit Freud und Leid der Protagonisten das prozedurale und emotionale Gedächtnis. Durch die Arbeit mit Metaphern und Geschichten – ein wichtiger Bestandteil des L im NLP – erleichtern wir den Zugang zu den grundlegenden Informationsverarbeitungsmechanismen unseres Gehirns.
Denn neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass das Gehirn bei der Verarbeitung von abstrakten Konzepten wie „psychischem Schmerz“ oder „finanziellen Risiken“ auf körperlich-konkrete Analogien zurückgreift, um diese Konzepte zu repräsentieren. Wir verarbeiten diese nämlich mit anatomischen Strukturen der Körperwahrnehmung, zum Beispiel mit Zentren für Ekel und Schmerzen (Kuhen & Knutson, 2005; Macdonald & Leary, 2005).
Wenn wir – zum Beispiel im Coaching oder im Seminar – mit der konkreten Erfahrung beginnen, dann ersparen wir dem Gehirn das stoffwechselintensive Rückübersetzen des Abstrakten ins Körperliche – wir starten gleich auf der konkreten Ebene, auf der das Gehirn mit „embodied concepts“ am leichtesten Informationen verarbeitet (Lakoff & Johnson 1999). Vom Bodenanker über die Arbeit mit Stühlen und Timelines bietet NLP jede Menge an Formaten, die dieses Körpergedächtnis aktivieren und damit den modus operandi unseres Gehirns optimal nützen.
Prinzip 10: Lernen ist entwicklungsab-hängig.
Die kognitive und emotionale Reifung eines Individuums beeinflusst, wie Lernprozesse gestaltet werden können. Beispielsweise sind die Abstraktionsfähigkeiten eines Achtjährigen anders ausgeprägt als die eines Zwölfjährigen, was auf die unterschiedliche Reifung des Präfrontalkortex zurückzuführen ist. Studien zeigen jedoch, dass die Ausbaustufe des Präfrontalkortex auch bei Erwachsenen oft stark variiert. Eine höhere Gyrifizierung (also mehr Furchen und Hirnwindungen) wurden mit höherer geistiger Flexibilität und Arbeitsgedächtniskapazität in Verbindung gebracht (Gautam et al. 2015). Ähnliche Befunde gibt es für die emotionale Reifung, zum Beispiel durch die Zunahme der grauen Substanz in Regionen des Cortex, die für die emotionale Selbststeuerungsfähigkeit zuständig sind – zum Beispiel im Rahmen von Achtsamkeitsübungen (Kang et al., 2013).
Im Gegensatz zu den Anfangsjahren des NLP liegen uns heute massenweise Studien vor, die die Entwicklungsmöglichkeiten unseres Gehirns durch unterschiedliche Interventionen auch und gerade im Erwachsenenalter eindrücklich belegen. Wer daher über die aus heutiger Sicht vielleicht etwas mechanistische Metapher des „Programmierens“ (des P im NLP) die Nase rümpft, kommt dennoch nicht an am Faktum einer ungeahnt weitgehenden Programmierbarkeit unseres Gehirns durch unsere eigene Wahl und unsere eigene Erfahrung vorbei.

Prinzip 11: Komplexes Lernen wird durch Herausforderung gefördert.Angst und Bedrohung behindern das Lernen.
Die Stressbiologie zeigt, dass moderate, selbstgewählte Herausforderungen neuroprotektiv wirken und die Neuroplastizität fördern (Kirby et al. 2013). Im Gegensatz dazu führen überschwellige Mengen an Stresshormonen wie Noradrenalin und Cortisol bei chronischem Stress zu neurotoxischen Effekten, die die Konnektivität im Gehirn reduzieren und sogar graue Substanz abbauen können (Kaufer & Freidman, 2014).
Insbesondere durch die erwähnten Methoden zur Assoziation und Dissoziation, aber auch durch das Ankern oder Formate wie die sogenannte „Phobietechnik“ oder „Change History“ erhalten NLP-Anwender wirksame Mittel für das Management unterschiedlichster Stressoren an die Hand.
So gelingt der Wechsel vom passiv erduldeten, gesundheitsschädlichen „Beutetier-Stress“ zum gesunden, da aktiv aufgesuchten und kurzzeitigen Stress (Sapolsky, 2021). Mit jedem aktiv bewältigten Stressor wachsen dann die Selbstwirksamkeitserwartungen sowie die Lust und Kompetenz, die Herausforderungen des Lebens freudig anzugehen.
Prinzip 12: Jedes Gehirn ist einzigartig.
Dieses letzte neurodidaktische Prinzip verweist auf die Individualität jedes menschlichen Gehirns. Durch genetische Unterschiede und unterschiedliche Lebenserfahrungen entstehen hochgradig individuelle synaptische Verbildungsmuster. Diese Vielfalt führt dazu, dass jeder Mensch die Welt subjektiv anders erlebt und verarbeitet.
Im NLP steht die wertschätzende Anerkennung dieser Subjektivität im Mittelpunkt. So betont etwas das Axiom „Die Landkarte ist nicht das Gebiet“, dass jeder Mensch seine eigene innere Landkarte besitzt, die seine Wahrnehmung der äußeren Realität formt. Dieser Respekt gegenüber den Weltmodellen der anderen Menschen setzt sich dabei ins Selbstverhältnis fort. NLPTechniken wie das Six-Step Reframing etwa fördern den Respekt vor den eigenen inneren Anteilen, indem sie die positive Absicht hinter jedem Verhalten anerkennen. Statt unerwünschte Verhaltensweisen zu verurteilen, wird nach alternativen Wegen gesucht, um diese positive Absicht zu verwirklichen.
In der Rückkoppelung zwischen Innen und Außen kann ein dergestalt kultivierter freundlicher Selbstbezug den Boden für ein gedeihliches Miteinander bereiten. In einer Zeit globaler Krisen, politischer Radikalisierung und zunehmender Konflikte wird es immer wichtiger, Brücken zwischen unterschiedlichen Weltmodellen zu bauen und Andersdenkenden wertschätzend zuzuhören. Dann hat der Wunsch nach Frieden und einer genialen Zukunft für uns und unsere Kinder eine realistische Chance. Lasst uns die Potenziale des NLP nutzen, um mit uns selbst und miteinander liebevoll und freudig leben zu lernen!
Dr. Franz Hütter ist als Naturwissenschaftler, Geisteswissenschaftler und erfahrener Praktiker Brückenbauer zwischen Wissenschaft und der Welt des Trainings und Coachings.
Mit seiner TÜV-zertifizierten Scientific Trainer Ausbildung hilft er Kolleginnen und Kollegen, ihre wertvolle Arbeit wissenschaftlich zu fundieren, weiterzuentwickeln und zu positionieren.
Franz ist überzeugt, dass es in unserer Zeit nichts Wichtigeres gibt, als menschliche Entwicklung und Lernen. Die Multiplikatoren des Lernens dabei zu unterstützen, einflussreich und wirksam zu werden, ist seine größte Leidenschaft.
Mehr über Dr. Franz Hütter: Scientific Trainer Ausbildung